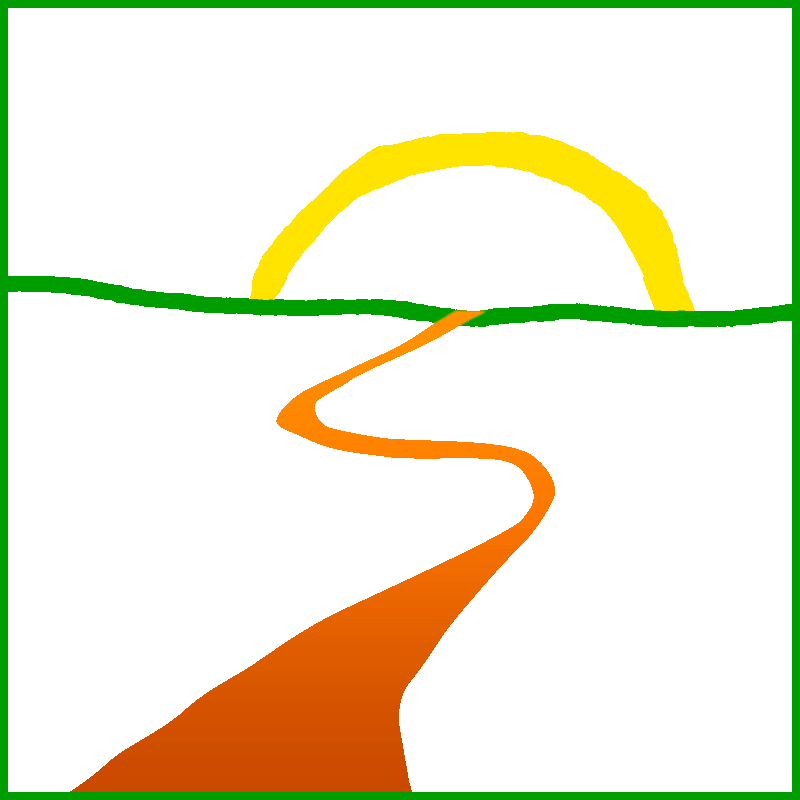Es war an einem Donnerstag im Jahr 2016, lange, bevor ich auf die Idee mit dem PCT gekommen war. Und ich weiß noch, dass es warm draußen war und ich mit dem Motorrad in Uffenheim war. Eine Therapiestunde stand an – und es wurde eine ganz Besondere. Nachdem ich ein bisschen über mein aktuelles Befinden gesprochen hatte, schlug mein Therapeut eine Imaginationsübung vor. Meistens habe ich mich vor diesen Übungen gefürchtet, denn ich war nie sicher, wie sehr es mich belasten würde, ob ich völlig die Fassung verlieren würde oder was sonst noch so alles an Horrorszenarien in meinem Kopf herumspukte. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch mutig sein, mich meinen Themen stellen und nicht mein Gesicht vor dem Therapeuten verlieren, obwohl diese Gefahr sicherlich nie bestand. Also ließ ich mich auch an diesem Tag auf diesen Vorschlag ein.
Als ich mich mit geschlossenen Augen und der entsprechenden Konzentration vorbereitet hatte, schlug er mir vor, ich solle doch einmal meine Mutter vor meinem geistigen Auge erscheinen lassen. An dem Mutter-Thema waren wir schon länger dran. Die Szene, die nun vor meinem geistigen Auge entstand, spielte im Wohnzimmer des elterlichen Hauses in Berlin, ich sah den Raum deutlich vor Augen, darin meine Mutter in einem knielangen Rock mit einem grau-rotem Karomuster. Unter der Anleitung des Therapeuten versuchte ich mich der Situation zu stellen und merkte plötzlich, dass ich mit gesenktem Kopf nur den Saum, also das untere Ende des Rocks anschauen konnte, jedoch nicht ins Gesicht meiner Mutter blicken konnte. Ich konnte den Kopf nicht heben, um ihr die lauten und wütenden Worte ins Gesicht zu schleudern, über die wir vorher gesprochen hatten und die loszuwerden mich sicherlich erleichtert hätte. Dann fiel mir auf, dass ich nicht nur in der Imagination, sondern auch auf dem Stuhl im Zimmer wie zusammengefaltet saß, vornüber gebeugt, wie es stärker nicht möglich war.
Das war eine sehr harte Erfahrung. Es brauchte auch nach Ende der Imagination einige Zeit, bis ich wieder halbwegs gerade auf dem Stuhl sitzen konnte, die gebeugte Stellung schien zunächst passender zu sein. Als wir später darüber sprachen, erinnerte ich mich, dass ich als Jugendlicher immer das Gefühl hatte, gebeugt durchs Leben zu gehen. Und nachdem mir das aufgefallen war, sagte ich mir innerlich immer: Richte Dich auf, gehe gerade! Und investierte Energie, um das Gefühl zu erzeugen, nicht mehr gebeugt zu sein. Das erzählte ich ihm, und ich glaube nicht, dass ich jemals zuvor mit irgend jemandem darüber gesprochen hatte. Aber in den darauf folgenden zwei Tagen merkte ich, dass dieses Gefühl wieder akut war und ich mich bemühen musste, gerade und aufrecht zu gehen, oder mich wenigstens wieder so zu fühlen. Eine alte Spur war sichtbar geworden, und wenn ich jetzt gerade darüber schreibe, spüre ich den Widerhall dieser Erfahrung als Schmerz in meinen Schultermuskeln und im Rücken.
In den letzten Tagen denke ich öfters an diese Therapiestunde zurück. Denn ich merke, dass sich mit dieser Erfahrung tatsächlich etwas verändert hat. Ich bin „gerader“ geworden in den letzten zwei Jahren. Das spüre ich, wenn ich mich einer an sich angstbeladenen Situation stelle, in der es darum geht, mich für meine Rechte und Wünsche stark zu machen und gegenüber einer anderen Person gleichberechtigt aufzutreten. Mir ist erst in dieser Woche so richtig aufgefallen, als ein solch klärendes Gespräch anstand, dass es sich ganz anders anfühlt als früher. Ich habe noch immer Angst, aber meist stelle ich mich trotzdem der Situation, stehe sie durch und erreiche meistens sogar meine Ziele.
Ich bin froh und unglaublich dankbar für diese Veränderung. Gleichzeitig spüre ich ein großes Gefühl der Dankbarkeit für die heftige Therapiestunde und für meinen Therapeuten, mit dem ich mich durch diese intensive Erfahrung stark verbunden fühle. Und er schrieb mir, dass er dafür dankbar ist, diesen Moment miterlebt haben zu dürfen.
Ich habe mich aufgerichtet.